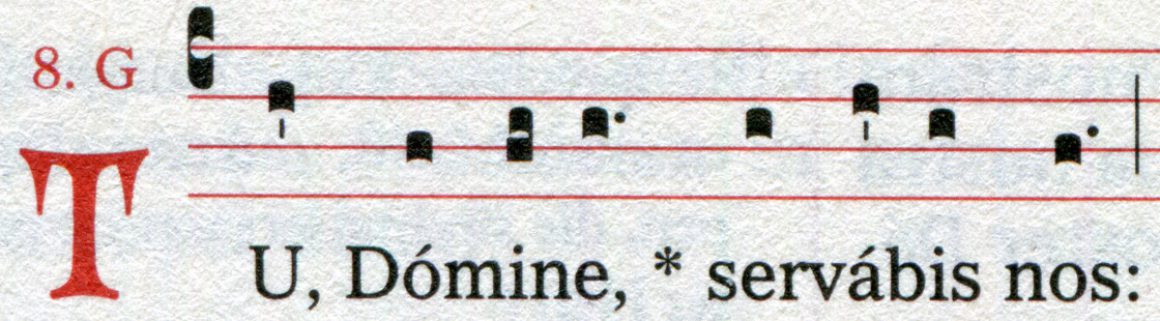Der Kreuzestod Jesu unter medizinischen Gesichtspunkten – (Der besseren Lesbarkeit willen wird an dieser Stelle auf die im Original angegebenen Verweise verzichtet.)
Von Dr. med. Ewa Kucharska
(4) Zeugnis des Turiner Grabtuches
Eines der authentischen Zeugnisse des Leidens und der Kreuzigung von Jesus ist das Turiner Grabtuch. Papst Johannes Paul II. hielt das Leinen für einen „schweigenden Zeugen des Todes und der Auferstehung“, obwohl die Kirche nicht offiziell dazu Stellung nahm.
Die Ergebnisse der durchgeführten Untersuchungen spiegeln das Bild der grausamen Folter und des Kreuzes wider und geben eine Vorstellung davon, wie schrecklich das Leiden des Verurteilten war. Das Leinen mit einer Länge von 4,36 m und einer Breite von 1,10 m ist, wie heute angenommen wird, eine Fotoplatte mit dem vorderen und hinteren Teil des Körpers des Opfers. Sie entstand von innen infolge einer Explosion geheimnisvoller Energie wegen des Anbrennens der Oberfläche von Fasern durch Infrarotstrahlung oder Protonenbeschuss, was immer noch ein ungelöstes wissenschaftliches Rätsel ist. Das dreidimensionale Bild auf dem Tuch ist im Foto negativ, die Blutflecken im Positiv sichtbar.
Aufgrund der Untersuchungen konnte man feststellen, dass die gekreuzigte Person ein Mann mit einer Größe von 181 cm, einem Gewicht von 65 kg, mit semitischen Gesichtszügen und einem starken gleichmäßigen Körperbau war.
Die Untersuchungen des Grabtuches ergaben, dass der Körper darin 36 Stunden verblieben war, da es auf dem Leinen keine Verwesungszeichen gibt. Auf dem Grabtuch fanden sich unversehrte Blutspuren, ohne Spuren des Abreißens, was beweisen kann, dass die Leiche aus dem Leinen nicht herausgenommen wurde. Aus den Untersuchungen ergibt sich auch, dass das Blut auf dem Leinen menschliches Blut der Gruppe AB ist.
Es wurde darin ein Pigment der Galle festgestellt. Es ist bemerkenswert, dass sich eine übermäßige Menge des Bilirubins im Blut wegen der erhöhten Produktion infolge einer großen Anstrengung (Leiden, Schmerz) sowie einer geringgradigen Hämolyse in der Leber finden kann. Die Art des Todes hing von der Art und Weise der Befestigung des Opfers am Kreuz ab. Wenn das Opfer mit den traditionell gestreckten Armen am Kreuz hing, hatte es keine Atemprobleme. Die von Zugibe durchgeführten Untersuchungen bewiesen, dass der Tod in einem solchen Fall durch die orthostatische Hypotonie verursacht wurde.
Wenn die Arme über dem Kopf gestreckt waren und das Opfer hing, konnte der Tod in einer Stunde oder einer Minute erfolgen, da das Opfer die Arme nicht nutzen konnte, um den Körper zum Ausatmen anzuheben. Wir wissen, dass normalerweise am Ausatmen zwei Gruppen von Muskeln teilnehmen, d.h. Zwischenrippenmuskeln und Zwerchfell. Wenn das Opfer mit den Armen über dem Kopf hängt, können diese Muskelgruppen nicht arbeiten, so dass das Opfer nicht ausatmen kann und erstickt.
Die Todesursache bestand aus mehreren Faktoren. Der Tod von Jesus konnte – wie Prof. Sienkiewicz und andere betonen – mit einer Beschädigung des Brustkorbs noch vor der Kreuzigung verbunden sein, was das Vorhandensein einer bluthaltigen Flüssigkeit in der Pleurahöhle und das sog. Nasse-Lunge-Syndrom verursachen konnte. Die Anzeichen sind in diesem Fall beschleunigtes Atem, Atemnot, Zyanose und Verminderung der Sauerstoffkonzentration im Blut mit dem Anstieg der Kohlendioxidkonzentration.
Auf Grundlage der Untersuchungen wissen wir, dass Jesus an eine niedrige Säule angebunden und gebeugt war. Sein ganzer Körper, hauptsächlich Rücken, Oberschenkel und Waden wurden gefoltert. Der Kopf, der Unterbauch und die Nähe des Herzens blieben verschont, um einen zu schnellen Tod zu vermeiden. Jesus trug das Kreuz von der Burg Antonia bis zum Gipfel von Golgota. Er litt seelisch und physisch.
Wegen des erheblichen Kraftverlustes infolge des Leidens konnte er das Kreuz nicht tragen. Durch erheblichen Blutverlust, Schlafmangel, nach schweren Erlebnissen und gleichzeitig im ungünstigen Klima kam es zu seinem Tod. Infolge des Sturzes hatte Jesus eine Schulterverwundung.
Es gibt zahlreiche Diskussionen über die Nagelstellen in den Händen von Jesus. Wie der deutsche Theologe Martin Hengel meint, konnten die Hände das Körpergewicht nicht tragen. Besser geeignet wären dafür die Handgelenke. Die Nägel wurden in die Handwurzeln zwischen den Handwurzelknochen oder der Speiche und den Handwurzelknochen hineingeschlagen. Der Nagel verursachte keine Frakturen, aber infolge der Beschädigung der mit Nerven durchzogenen Knochenhaut verursachte er starke Schmerzen.
Bei der Beschädigung des Mittelarmnervs kamen reißende Schmerzen beider Arme, Lähmung eines Teils der Extremität und ischämische Kontrakturen vor. Die Nägel wurden sachkundig eingeführt, damit die Arteria radialis und die Arteria ulnaris nicht beschädigt werden. Die Nägel haben gewöhnlich das Kreuz durchgeschlagen. Sie wurden durch die erste oder die zweite Zone des Mittelfußes hineingeschlagen, beschädigten den N. peroneus und den Zweig des N. plantaris, was grausame Schmerzen verursachte. Die Extremitäten waren kniegebogen und seitlich gedreht.
Die Agonie wurde oft durch Brechen der Beine unterhalb der Knie verkürzt. Das war manchmal eine Erlösung für den Verurteilten. Wie Prof. Sienkiewicz und andere glauben, starb Jesus wahrscheinlich 6 Stunden nach der Kreuzigung. Es wird auch die Frage diskutiert, ob Er seinen Kopf hängen ließ und einen Schrei als Anzeichen des Todes ausstieß. Wahrscheinlich war eine Ruptur der Wand des linken Ventrikels und die Füllung des Herzbeutels mit Blut. Es ist auch zur verstreuten Blutgerinnung innerhalb von Gefäßen und dann zum Verschluss der Koronargefäße mit thromboembolischem Material gekommen, was akute Ischämie und sekundären Herzinfarkt verursachte.
Untersuchungen in mehreren Instituten bewiesen, dass es kaum zu glauben ist, dass Jesus den Lanzenstoß in die Seite und den Blut- und Wasserverlust überlebte. Die Beschädigung der Kontinuität der Gewebe sowie riesige Störungen im Flüssigkeits- und Elektrolythaushalt und massive intravaskuläre Gerinnung schränken diese Möglichkeit ein.
(Dr. med. Ewa Kucharska: „Der Kreuzestod Jesu unter medizinischen Gesichtspunkten“ – Erschienen in THEOLOGISCHES, Juli/August 2014)

+