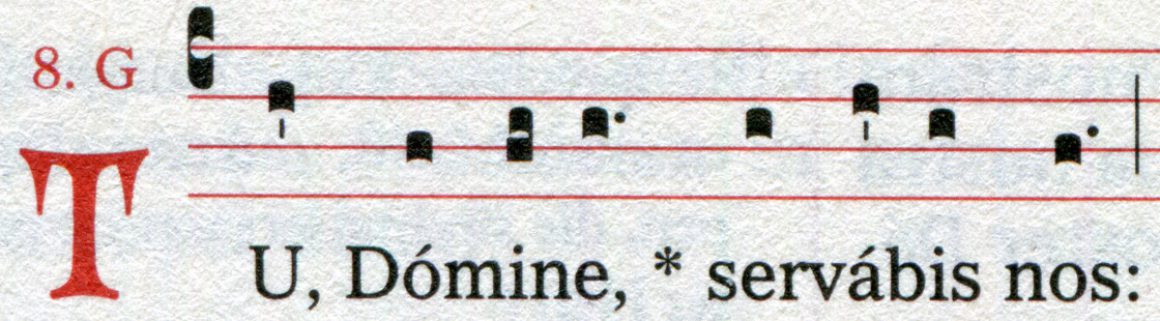„Wir haben nur einen Grund traurig zu sein,
– daß wir nicht heilig sind.“
(Leon Bloy)
+
Hinweis zum Buch
PATER M. RAYMOND
EIN MENSCH WIRD FERTIG MIT GOTT
Vom Cowboy zum Trappisten
+
Der Trappistenautor Pater M. Raymond (Joseph David Flanagan, 1903-1990) trat 1936 in das Trap-pistenkloster Unsere Lieben Frau von Gethsemani in Kentucky ein. Er verfasste zahlreiche Bücher, die z. T. ins Deutsche übersetzt wurden. Bekannt sind „Die drei Rebellen“ über die Anfänge des Zister-zienserordens in Citeaux und „Die weißen Mönche von Kentucky“, ein Buch, in dem der Autor die Entstehungsgeschichte seines Klosters beschreibt. In Gethsemani war Pater Raymond Zeitgenosse seines berühmteren Mitbruders Pater Louis (Thomas Merton), der ihn jedoch als Autor nicht schätzte.
1941 veröffentlichte Pater Raymond sein Buch „The man who got even wich God“. Es handelt sich um eine romanhafte Biografie des zwei Generationen vor ihm im selben Kloster lebenden Laienbruders Joachim, der als John Green Hanning (1849-1908) nur unweit der Trappistenabtei in Kentucky aufgewachsen ist. Das Buch ist in den USA vielfach nachgedruckt worden. Es wurde auch in viele Sprachen übersetzt und hat sogar in Deutschland mehrere Auflagen erfahren. Sein deutscher Titel lautet: „Ein Mensch wird fertig mit Gott. Vom Cowboy zum Trappisten“.
Mit den aufgeklärten Augen der heutigen Zeit gelesen handelt es sich um einen unmögliches Buch. Kein deutscher Verlag würde es heute so veröffentlichen. Nicht nur, dass die Sprache altmodisch erscheint, sie ist vor allem nicht „politisch-korrekt“. Ebenso hat sich das Bild von einem frommen und religiösen Leben vollständig gewandelt. Ein, wie hier geschildertes Klosterleben scheint dem modernen und vor allem „nachkonziliaren“ Menschen nicht nur wie unwirklich, sondern geradezu unmenschlich zu sein. Warum also sollte jemand dieses Buch lesen?
„Ein Mensch wird fertig mit Gott. Vom Cowboy zum Trappisten“.
Pater Raymond hat in Gethsemani schon als junger Mönch durch seine älteren Mitbrüdern von Bruder Joachim gehört. In den Archiven des Klosters suchte er nach Aufzeichnungen, wovon allerdings nicht viel zu finden war. Doch das beflügelte den Autor umso mehr, zwar keine Biografie, dafür aber eine romanhafte Lebensbeschreibung zu verfassen. Was er gehört hatte und in den Klosterannalen fand, verarbeitete er zu einem spannenden Triller. Dabei fließen geschichtliche Ereignissen des 19. Jahr-hunderts ebenso ein wie die gesellschaftlichen Gegebenheiten jener Zeit.
Die etwas reißerisch daherkommenden Titel und Untertitel passen vielleicht zum Stil des Romans, auch nicht unbedingt zu einer Beschreibung des geistlichen Weges eines Trappistenmönches. Das als derbe beschrieben Klosterleben erinnert an heroische Zeiten. Beinahe so, als sei man im 17. Jahrhundert in La Trappe und bei Abt de Rance, dem Gründer der Trappisten. Es ging darum, heilig zu werden. Dafür kam man in solche Klöster. Das schaffte man aber nur, so war man der Ansicht, wenn es gelang, das eigene Ich abzutöten. Die dabei notwendigen Härten, die sich vor allem im Gehorsam dem Vater Abt, dem Oberen gegenüber zeigten, halfen dabei, den Mönch näher zu Gott zu führen. Dieser harte Weg vollzieht sich anhand der klösterlichen Gelübde von Armut, Gehorsam und Keuschheit. Das Ziel ist der Himmel.
Das Buch gewährt diesen Einblick in das Mönchs- insbesondere des Trappistenlebens- jener Zeit. Es wird die Opferbereitschaft und der Heldenmut jener Männer deutlich, die das Klosterleben ergriffen, um Gottes Ruf zu folgen und bereit waren wirklich alles hinzugeben, sogar ihren eigenen Willen mit ihrem ganzen Leben. Hier wird klar, dass Menschen der heutigen Zeit kaum Verständnis für jene Sichtweise aufbringen können: den eigen Willen aufzugeben für Gott widerspricht der modernen Idee, seinen eigenen Willen ausleben zu müssen. Nein, einem anderen vorbehaltlos zu vertrauen und zu folgen, sich den eigenen Willen brechen zu lassen, ist dem modernen Menschen nicht vorstellbar. Doch vielleicht wird er nach der Lektüre dieses Buches erkennen, dass gerade der moderne Mensch sich mehr und mehr einem fremden Willen (Medien, Mainstream, usw.) unterwirft und in Wirklichkeit keinen eigenen Willen mehr besitzt. – Doch was ist schöner und größer, als sich Gottes Willen anzuvertrauen…
+