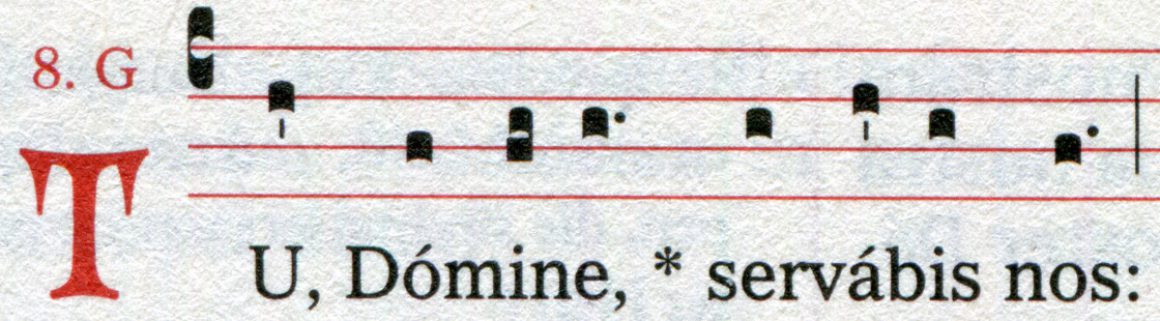Der Abt der traditionellen Benediktinerabtei von Fontgombault hat im jüngsten Brief an die Freunde des Klosters an Papst Benedikt erinnert, der 2001 als Kardinal Ratzinger das Kloster besuchte.
+
Als das Jahr 2022 und die Oktav von Weihnachten zu Ende gingen, übergab der gute Papst Benedikt XVI. seine Seele Gott.
Ist es nicht ein Akt der Vorsehung, diese einfache, klare Kinderseele, die an einem Karsamstag auf die Welt gekommen war, in der Weihnachtszeit wieder ins Leben gerufen wurde?
Kardinal Ratzinger kannte unseren früheren Abt Antoine Forgeaut gut. Im Laufe der Jahre waren Beziehungen gegenseitigen Vertrauens entstanden. Beide fanden sich in einer starken Liebe zu Christus und seiner Kirche wieder, und in dem Wunsch, daran zu arbeiten, ihre Wunden zu heilen, insbesondere im Bereich der Liturgie.
Abt Antoine liebte es, Kardinal Meisners Worte über Kardinal Ratzinger zu wiederholen: „Intelligent wie zwölf Professoren und fromm wie ein Erstkommunionkind“. Die Abtei verliert einen Freund auf Erden. Sie gewinnt einen im Himmel.
Papst Benedikt war wahrlich „von Gott gesegnet“, gesegnet mit den Gaben der Intelligenz, des Gedächtnisses und der Sensibilität, die ihm eine außergewöhnliche Unterscheidungsfähigkeit verliehen, die er sehr früh, als demütiger Diener, in den Dienst der Kirche zu stellen wusste.
Papst Ratzinger war ein Mann des Friedens; des Friedens, der von Gott kommt und der die Wahrheit verlangt. Dieses unaufhörliche Streben nach Wahrheit machte ihn zu einem freien Mann, der die Worte Jesu anwenden konnte: „Meine Lehre stammt nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat“ (Joh 7,16). Sein Leben und seine Gaben setzte er gemäß seinem Motto „Cooperatores veritatis – Mitarbeiter der Wahrheit“, für ein doppeltes Ziel ein: die Läuterung – Reinigung und die Verherrlichung der Wahrheit.
Die Wahrheit wird euch frei machen (Joh 8,32). Diese Freiheit von Klischees und vorgefertigten Meinungen hat Kardinal Ratzinger und später Papst Benedikt XVI. stets für sich beansprucht. Sie hat ihm nicht nur Freunde eingebracht! Er steckte schon in einer bestimmten Meinungs-Schublade, lange bevor er den Stuhl Petri bestieg. Kritik erhielt er so reichlich, und manchmal von denen, deren Mission es war, ihm zu helfen.
Ich sehe vor allem drei Bereiche, in denen Papst Benedikt dieses Werk der Reinigung der Wahrheit fortgesetzt hat:
Kardinal Ratzinger war ein leidenschaftlicher Verteidiger des Zweiten Vatikanischen Konzils, an dem er selbst teilgenommen hatte. Aber die richtige Umsetzung des Konzils erforderte seiner Meinung nach, eine Klarstellung der Hermeneutik, d.h. der allgemeinen Linie, die bei der Interpretation der Konzilstexte vorherrschen sollte. In seiner Ansprache an die Kurie anlässlich des Austausches von Gewändern am 22. Dezember 2005 sagte er:
„Auf der einen Seite gibt es eine Auslegung, die ich ‚Hermeneutik der Diskontinuität und des Bruches‘ nennen möchte; sie hat sich nicht selten das Wohlwollen der Massenmedien und auch eines Teiles der modernen Theologie zunutze machen können. Auf der anderen Seite gibt es die ‚Hermeneutik der Reform‘, der Erneuerung des einen Subjekts Kirche, die der Herr uns geschenkt hat …“
Zwischen dem Streben nach einer Erneuerung, die die Vergangenheit ignoriert, und der Aufrechterhaltung eines starren Status quo, erinnert Benedikt XVI. einfach daran, dass die Kirche lebt und sich weiterentwickeln muss, indem sie immer dieselbe bleibt und sich doch erneuert.
Papst Benedikt musste sich auch mit den ersten Enthüllungen des weit verbreiteten sexuellen Missbrauchs durch Priester und Ordensleute auseinandersetzen. In den ersten Monaten seines Pontifikats ging er entschlossen und mutig mit den Fällen um, die er aus seiner vorherigen Funktion als Präfekt der Kongregation für die Glaubenslehre kannte. Aber es war im Priesterjahr 2009-2010, dass die brutale Wahrheit ans Licht kam und das ganze Ausmaß sichtbar wurde.
In der Predigt bei der Abschlussmesse dieses Gnadenjahres am 11. Juni 2010, dem Fest des Heiligsten Herzens, sagte er:
„So ist es geschehen, daß gerade in diesem Jahr der Freude über das Sakrament des Priestertums die Sünden von Priestern bekannt wurden – vor allem der Mißbrauch der Kleinen, in dem das Priestertum als Auftrag der Sorge Gottes um den Menschen in sein Gegenteil verkehrt wird. Auch wir bitten Gott und die betroffenen Menschen inständig um Vergebung und versprechen zugleich, daß wir alles tun wollen, um solchen Mißbrauch nicht wieder vorkommen zu lassen; daß wir bei der Zulassung zum priesterlichen Dienst und bei der Formung auf dem Weg dahin alles tun werden, was wir können, um die Rechtheit der Berufung zu prüfen, und daß wir die Priester mehr noch auf ihrem Weg begleiten wollen, damit der Herr sie in Bedrängnissen und Gefahren des Lebens schütze und behüte. Wenn das Priesterjahr eine Rühmung unserer eigenen menschlichen Leistung hätte sein sollen, dann wäre es durch diese Vorgänge zerstört worden. Aber es ging uns gerade um das Gegenteil: Das Dankbar-Werden für die Gabe Gottes, die sich „in irdenen Gefäßen“ birgt und die immer wieder durch alle menschliche Schwachheit hindurch seine Liebe in dieser Welt praktisch werden läßt. So sehen wir das Geschehene als Auftrag zur Reinigung an, der uns in die Zukunft begleitet und der uns erst recht die große Gabe Gottes erkennen und lieben läßt.“
Am 11. April 2019 veröffentlichte er einen Brief mit dem Titel „Die Kirche und der Skandal des sexuellen Mißbrauchs“, in dem er Papst Franziskus bei der Bekämpfung dieser Geißel und der Reform der Kirche zur Seite stehen wollte.
In diesem Brief erinnerte er an den gesellschaftlichen Kontext der 1960er und 1980er Jahre, als die Normen in der Sexualmoral zusammengebrochen waren. Für manche schien Pädophilie kein Problem darzustellen. Dieser Kontext blieb in den Seminaren und den verschiedenen Ausbildungsstätten nicht ohne Folgen, zumal in der Kirche eine weitgehend naturrechtlich begründete Moraltheologie in Frage gestellt wurde. Stattdessen wurde eine Situationsmoral vorgezogen, in der es nichts absolut Gutes und nichts grundsätzlich Schlechtes geben konnte. Alles blieb relativ und im Vagen, je nach Moment oder den Umständen.
„In der Tat wurde konziliare Gesinnung in vielen Teilen der Kirche als eine der bisherigen Tradition gegenüber kritische oder negative Haltung verstanden, die nun durch ein neues, radikal offenes Verhältnis zur Welt ersetzt werden sollte.“ Es mussten „die Rechte der Angeklagten garantiert werden und dies bis zu einem Punkt hin, der faktisch überhaupt eine Verurteilung ausschloß“.
Als Gegengewicht gegen die häufig ungenügende Verteidigungsmöglichkeit von angeklagten Theologen wurde nun deren Recht auf Verteidigung im Sinn des Garantismus so weit ausgedehnt, daß Verurteilungen kaum noch möglich waren. In seinem Brief erinnerte der emeritierte Papst auch an die richtige Interpretation der Worte Jesu, die bei Markus aufgezeichnet sind: Wer einen dieser Geringen die glauben, zu Fall bringt, für den wäre es weit besser, wenn ihm ein Mühlstein um den Hals gehängt und er ins Meer geworfen würde (vgl. Mk 9,42):
„Das Wort ‚die Kleinen‘ [Geringen] bezeichnet in der Sprache Jesu die einfachen Glaubenden, die durch den intellektuellen Hochmut der sich gescheit Dünkenden in ihrem Glauben zu Fall gebracht werden können. Jesus schützt also hier das Gut des Glaubens mit einer nachdrücklichen Strafdrohung an diejenigen, die daran Schaden tun. Die moderne Verwendung des Satzes ist in sich nicht falsch, aber sie darf nicht den Ursinn verdecken lassen. Darin kommt gegen jeden Garantismus deutlich zum Vorschein, daß nicht nur das Recht des Angeklagten wichtig ist und der Garantie bedarf. Ebenso wichtig sind hohe Güter wie der Glaube. Ein ausgewogenes Kirchenrecht, das dem Ganzen der Botschaft Jesu entspricht, muß also nicht nur garantistisch für den Angeklagten sein, dessen Achtung ein Rechtsgut ist. Es muß auch den Glauben schützen, der ebenfalls ein wichtiges Rechtsgut ist. Ein recht gebautes Kirchenrecht muß also eine doppelte Garantie – Rechtsschutz des Angeklagten, Rechtsschutz des im Spiel stehenden Gutes – beinhalten. Wenn man heute diese in sich klare Auffassung vorträgt, trifft man im allgemeinen bei der Frage des Schutzes des Rechtsgutes Glaube auf taube Ohren. Der Glaube erscheint im allgemeinen Rechtsbewußtsein nicht mehr den Rang eines zu schützenden Gutes zu haben. Dies ist eine bedenkliche Situation, die von den Hirten der Kirche bedacht und ernstgenommen werden muß.“
Fortsetzung folgt.
+