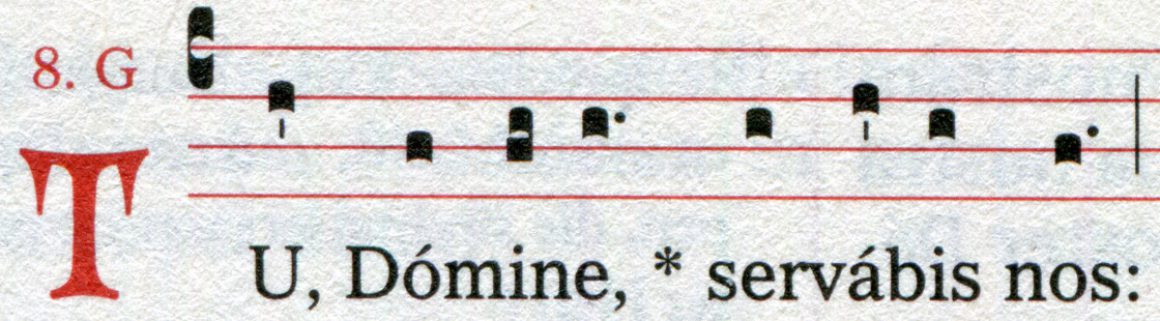Ein Hauptmotiv für das Anlegen des Bußgewandes, insbesondere des Bußgürtels ist die mortificatio (Kirchen-Lexikon 1, Auszügen):
Abtödtung als Act (Werk der Abtödtung), ist jede auf Schwächung der sinnlichen Triebe gerichtete Handlung oder Entsagung, als Tugend die im steten Kampfe mit der unordentlichen Begierlichkeit erworbene Beherrschung des niedern, sinnlichen Theiles der menschlichen Natur durch den höhern geistigen Willen.
Die Pflicht der Abtödtung, schon der Vernunft einleuchtend, weil ein menschenwürdiges Leben ohne Regelung und Beherrschung der sinnlichen Triebe unmöglich ist, ergibt sich für den Christen noch insbesondere aus seiner Berufung zum Leben der Gnade, aus dem ihm zur Nachahmung vorgestellten Beispiele des abgetödteten Lebens unseres Erlösers, aus der Vorschrift des Evangeliums (2Cor. 4,10. Hebr. 12,1-4. Luc. 9,23).
Dem Sünder dient sie als Mittel der Buße und Genugthuung, um die aus der Begierlichkeit entsprungene Sünde an der Begierlichkeit zu strafen und die als Wirkung und Folge aus der Sünde hervorgegangene Mehrung der unordentlichen Lust zu beseitigen; dem Gerechten als Mittel zum Fortschritt im Guten, da man nach den Worten des hl. Hieronymus nur so weit fortschreitet in der Tugend, als man sich selbst (d. h. seiner sinnlichen Natur) Gewalt anthut.
Um den Leib willfähriger zu machen, sich der Herrschaft des Geistes und der göttlichen Gnade und Liebe zu unterwerfen, werden mit großem Nutzen bei sehr vielen Seelen auch Fastenübungen, körperliche Bußwerke und Nachtwachen Anwendung finden, aber nur bei Befolgung nachstehender Regeln:
1. Sie sind nicht anders als unter vollster Unterwerfung unter den Gehorsam zu gestatten und dürfen nie dem eigenen Gutdünken überlassen werden. –
2. Es ist sorgfältig zu wachen, dass durch dieselben die Demuth und Bußfertigkeit des Herzens, nie aber die geistige Eitelkeit und Selbstgefälligkeit Nahrung gewinnen. –
3. Sie sind deßhalb in der Regel nicht zu erlauben, so lange die Seele nicht alles Ernstes daran geht, die unumgänglich nöthige Abtödtung der Rechthaberei und des Eigensinnes, der Zornmüthigkeit und des Neides und der Geschwätzigkeit auf sich zu nehmen. –
4. In Auflegung und Gestattung solcher äußerer Strengheiten ist stets Rücksicht zu nehmen sowohl auf die äußeren Verhältnisse, wie auf den moralischen Zustand der Person, denn nicht Alles ist Allen möglich, nicht Allen ist Alles nützlich. –
5. Die einmal übernommene Bußübung soll beharrlich beibehalten und nicht ohne genügenden Grund abgeändert oder aufgegeben werden. –
6. Um aber dieses zu ermöglichen, sowie zur Erprobung, ob der Anfänger Werke der Buße nicht bloß im ersten unklugen Eifer verlange, um sie nach kurzer Zeit wieder zu unterlassen, ist es zu rathen, dass man anfänglich nur Geringes auflege oder erlaube, und erst allmählich zu Schwererem fortschreite. –
7. Je weniger ein Bußwerk den Charakter des Außerordentlichen und Sonderlichen an sich trägt, je mehr es im Verborgenen und unbemerkt von Anderen vorgenommen werden kann, desto mehr empfiehlt es sich.
(Vgl.: H. Dannheimer, B. Probst OSB; Bussgürtel oder ärztliche Bandage? Zum christlichen Bussbrauchtum in Mittelalter und Neuzeit. – In Germania Monastica 126/2015)
+